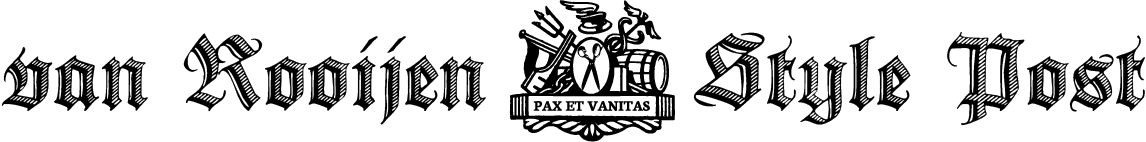In der aktuellen Ausgabe des deutsch-österreichischen Modemagazins „Flair“ steht ein längerer Text, den ich über die „Neue Romantik“ auf den Laufstegen geschrieben habe. Hier kommt meine Betrachtung …
MÄRCHEN GEGEN MISERY
Die Welt ist ganz schön aus den Fugen. Damit wir das aushalten, erzählt die Mode wieder Märchen – aber mit Biss: Punk-Prinzessin statt Normcore-Puttel heißt die Devise.
Am Mittwoch, den 23. September 2015 hätte die Welt untergehen sollen. Mehrere voneinander unabhängige Prognosen hatten es so angekündigt. Die Hobbyastronomen weissagten einen Meteoriteneinschlag vor der Küste von Venezuela, der die Welt in eine neue Eiszeit stürzen würde. Andere Verschwörungstheoretiker sagten die Ex- plosion einer Atombombe in Manhattan voraus. Dann gab es die Gruppe jener Endzeit-Apologeten, die erwarteten, dass sich durch das Einschalten des Teilchenbeschleunigers am Cern in Genf ein schwarzes Loch öffnen würde, das die Welt vernichtet. Und schließlich hieß es aus diversen gut unterrichteten ultrareligiösen Kreisen, es stünden der „Tag der Sühne“ und das zweite Erscheinen Jesu Christi auf Erden bevor.
Es wurde Abend… und nichts von alledem geschah. Am nächsten Morgen drehte sich die Welt unbeirrt weiter, die Apokalypse war wieder einmal vertagt. Dennoch hatten einige – sie weilten gerade auf der Fashionweek in Mailand – tatsächlich die Ankunft eines neuen Messias erlebt. Er sah mit seinem Bart und den Heilandsandalen sogar ein bisschen so aus, wie man sich Jesus vorstellt: Alessandro Michele zeigte seine zweite Show für Gucci, und die Fashionistas waren sich einig wie nie: Dieser eklektische Romantiker, der den schrägen Esprit der 70er-Jahre mit einem ausufernden Historismus verquirlt, ist der neue Heilsbringer. Seit Tom Ford hat es keine derart einhellige Begeisterung mehr für Gucci gegeben.
Alessandro Michele verstand diese Show als „situationistische Dérive“ – der Begri bezieht sich auf ein psychologisches Denkmodell der späten 60er-Jahre und beschreibt einen spontanen Trip durch eine Landschaft, bei dem sich der Reisende nur von ästhetischen Impulsen leiten lässt. Typisch Michele: Er bedient sich hier und dort: in der Vergangenheit, der Klamottenkiste, der Historie des Hauses und seiner eigenen Fantasiewelt. „Es ist nicht leicht, heute zu leben. Wir müssen auch träumen. Deswegen wollte ich eine romantische Idee zeigen, eine Art Traum, wie ein Film“, erklärte sich Michele am Tag darauf der US-Vogue.
Alessandro Micheles Aussage bringt ein Dilemma unserer Zeit auf den Punkt. Denn einerseits will und muss Mode immer ein Produkt ihrer Zeit sein. Sie re ektiert die Welt, für die sie gescha en wird. Andererseits ist diese Welt derzeit gerade so düster, bizarr und eigenartig geworden, dass sich die Mode auch als Antithese zur Realität anbietet. Als Flucht aus der immer härteren Wirklichkeit. Es gibt keine eindeutigen Leitmotive mehr. Die Permanenz des digitalen Lebens fordert uns alle extrem heraus. Und die Stabilität und Sicherheit, die wir uns nach dem Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges erhofft hatten, ist fort.
Vor 20 Jahren träumte man von der Verfeinerung der Kultur und der Verbesserung der Lebensumstände für alle. Stattdessen müssen wir nun feststellen, dass der Westen an seine Wachstumsgrenzen stößt. Neue dunkle Mächte bedrohen uns an Leib und Leben – islamistische Fanatiker versetzen mit ihrer eologie der Gewalt die Welt in Angst und Schrecken. Die Permanenz des Terrors frisst sich ins Bewusstsein. Es sind Migrationsströme in Bewegung, wie sie die Welt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Man wähnt sich in die Zeit der Kreuzzüge oder der europäischen Religionskriege zurückversetzt. Die Politik reagiert kopflos und radikalisiert die Menschen – in Europa genauso wie in Russland oder den USA.
Vor diesem Hintergrund ist es bestens nachvollziehbar, dass sich die Mode als geschönte, glückselige Parallelwelt präsentiert. Leichtigkeit und Romantik liegen in der Luft – wenn nicht in der Welt draußen, dann doch zumindest im Kleiderschrank. Die Designer scha en mit emotionsgeladenen Kollektionen kleine Fluchten aus der düsteren Realität. Da gibt es luftig-leichten Tüll und Organza, durchscheinende Spitzen und Stickereien, liebliche Blütenmotive, fein abgestuftes Pastell, zart den Körper umspielende Rüschen und Materialmengen, die an die Roben von Märchenprinzessinnen denken lassen.
Im Traum erscha en wir eine bessere Welt. Das Mittel dazu: mit Spitzen besetzte Unter- und Nachthemden oder kuschelweiche Pyjamas, wie sie allerorten in den Kollektionen zu finden sind. Man schaue sich nur die opulente und ver- spielte Mädchenmode von Chloé an. Die Kollektion von Etro ist voller ornamentaler Romantik – „Mehr ist mehr“. Selbst Céline bricht mit dem Minimalismus: „Ich möchte meine Kundin aus dem urbanen Leben nehmen und sie ermutigen, ihre Füße in den Sand zu setzen“, sagte Designerin Phoebe Philo, „ich sehne mich selber mehr und mehr nach dem Strand.“
Auch wenn nun also vielerorts Fluchten skizziert werden: Die Designer, welche die neue Romantik propagieren, sind keine weltfremden Idealisten. Romantik ist immer auch Ausdruck der Hoffnung, die Dinge mögen sich zum Besseren wenden. Die Modemacher nehmen also sehr wohl Bezug auf das, was in der Welt geschieht. Manchmal direkt, wie etwa Haider Ackermann, der seine dunkel- verträumten Draperien für den kommenden Frühling mit einer harten Kante und einem tribalen Dreh versieht – Punk trifft Prinzessin. Seine Träumerin ist auch eine Kriegerin.
Manchmal geschieht der Bezug aufs Weltgeschehen auch indirekt, wie bei Sarah Burton, die mit ihrer Frühjahrskollektion für Alexander McQueen an die protestantischen Hugenotten erinnerte, die Ende des 16. Jahrhunderts vor dem katholischen Klerus in Frankreich in alle Welt ohen, um nicht abgeschlachtet zu werden. Da waren sie wieder, die Religions- und Gotteskrieger – zwar im historischen „Gewand“, doch hat das ema unübersehbar mit der Aktualität zu tun. Die Spitzen, Stickereien und Rüschen verhießen Zartheit und Eleganz, doch die zerrissenen Säume und herabhängenden Bänder ließen die Looks gleichzeitig derangiert wirken.
Ein Aufblühen der Romantik, wie wir es jetzt erleben, geht kulturhistorisch betrachtet oft mit dem Ende einer Ära relativer Ruhe einher. So war es auch Ende des 18. Jahrhunderts, als die Französische Revolution ganz Europa veränderte. Der Kampf für bürgerliche Freiheitsrechte, die darauf folgende Konterrevolution und die Etablierung eines modernen Demokratieverständnisses begünstigten die Ausbreitung der Romantik. Die Bürger, gebildeter und kulturbeflissener denn je, sehnten sich nach Helden, Musik, Theater und Malerei, die ihnen eine Alternative zur Brutalität des Erlebten boten. Romantischer Eskapismus beeinflusste bis in die 1830er-Jahre hinein die Mode. Die Flucht ins Idyll gipfelte im Bieder- meierstil.
„Treibende Kraft der Romantik ist eine ins Unendliche gerichtete Sehnsucht nach Heilung der Welt, nach der Zusammen- führung von Gegensätzen zu einem har- monischen Ganzen“, ist im Internet über das letzte große Zeitalter der Romantik zu lesen. Die neue, oft überraschend romantische Mode des Frühlings 2016 darf ganz ähnlich interpretiert werden. Der sentimentale Gefühlsreichtum, den die Designer auf den Laufsteg senden, ist das beste Rezept gegen die Brutalität der zeitgenössischen Schlachtfelder.
Der Designer, der dieses Heilmittel anbietet, weiß um die beschränkte Wirkung seines Tuns. Ein Zwiespalt, der ihm zu schaffen macht – und den nicht jeder aushält. Keiner hat das so deutlich gemacht wie seinerzeit Alexander McQueen, der sich selbst einmal einen „romantischen Schizophrenen“ nannte. In seiner Arbeit lässt sich ein Grundthema der Romantik erkennen: die „gequälte Seele“. McQueen litt, obwohl er sich auf dem Zenit seines beruflichen Erfolgs befand, unter Depressionen und Angstgefühlen, bevor er seinem Leben 2010 ein Ende setzte.
Das Victoria and Albert Museum in London hat Alexander McQueens Schaffen im Frühsommer 2015 mit „Savage Beauty“ eine von Publikum wie Kritikern gleichermaßen geschätzte Ausstellung gewidmet. Diese Schau hat andere Designer unübersehbar beein usst. McQueens leidenschaftliche Art, das Raue und Düstere mit ephemerer Leichtigkeit und Schönheit zu kombinieren, nahm den Zustand unserer Welt vorweg. Der bloße Minimalismus und das spröde Normcore-Phänomen – bereits wieder abgelegte Leitmotive der jüngeren Mode – wurden den Sehnsüchten unserer Zeit nicht gerecht. Darum brauchen wir nun einen guten Schuss Märchen, Romantik, Schönheit und Wahnsinn. Andernfalls ist all das, was da draußen auf uns nieder- prasselt, nicht recht auszuhalten.
Illustration im Header: © Gayane Hakobjanyan, Maike Peterson / Esmod Berlin