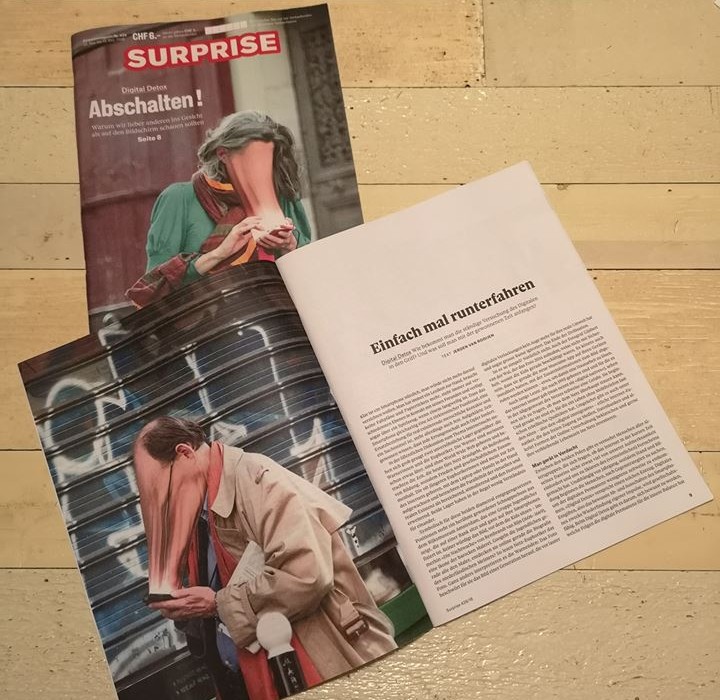Das mit dem Digital Detox, angeschoben im Herbst 2015, bleibt auch drei Jahre später ein schwieriges Thema. Digitale Permanenz, ein Symptom des zeitgenössischen Lebens, scheint unvereinbar mit dem vielerorts spür- und hörbaren Wunsch nach einem ruhigeren, fokussierteren und kreativeren Dasein. Es fühlt sich jetzt so an, als würde uns das digitale Zeitalter die letzten Zeit- und Musse-Reserven wegfressen. Optimisten werden neue Kreativität im Nonstop-Verdaddeln von Zeit auf Facebook, Instagram und Co. sehen. Tatsächlich haben diese Portale Menschen über Zeiträume und Distanzen vernetzt, die früher unüberwindbar waren. Doch gleichzeitig haben sie vielen den Verstand geraubt und den Sinn für das tatsächliche Dasein in Fleisch und Blut genommen.
Social Media sind wie eine Droge: Sie machen schnell high und glücklich, doch man kommt nicht mehr davon los. Ist man nicht online, ist man „auf dem Aff“, verliert die Geduld und bekommt das Gefühl, vom Zeitfluss abgekoppelt zu sein. Dazu kommt, dass sich diese Dienste inzwischen auch als unverzichtbare Komponente des merkantilen Lebens positioniert haben: Ohne Social Media ist kein rechtes Geschäft mehr zu machen. Man nutzt die Portale, um sich (oder seine Firme resp. Dienstleistungen) zu vermarkten. Natürlich wissen Google, Facebook & Co. das und lassen sich diese Leistung gut bezahlen. Wer etwas zu bieten hat und gesehen werden will, muss heute blechen. Sobald einen diese Firmen als Dienstleister identifiziert haben, ziehen sie die Daumenschrauben an (sprich: schrauben die Sichtbarkeit runter) und bringen einen dazu, Geld dafür zu überweisen, um beachtet zu werden. Wer auch nur einmal gezahlt hat für eine zeitweise Präsenz auf Google, Facebook oder Instagram, der weiss, dass er fortan ein Sklave dieser Portale ist.
Von diesen und ähnlichen Dingen handelt ein längerer Text, den ich dieser Tage unter dem Titel «Einfach mal runterfahren» für das Strassenmagazin SURPRISE geschrieben habe. Er war das Titelthema der Ausgabe von Anfang Dezember und stand neben einem lesenswerten Selbstversuch des preisgekrönten Romanautoren Thomas Meyer («Wolkenbruch»), den ich sehr schätze. Meyer ist seit seinen Jugendjahren als Werbetexter, in denen er parallel als «Hans Schmerz» auftrat, einen weiten Weg gegangen. Es ehrt und freut mich, über zwanzig Jahre später direkt mit ihm in der gleichen Ausgabe von SURPRISE zu stehen. Es handelt sich dabei um genau das Magazin, das einem meist in Bahnhofsnähe von Randständigen angeboten wird: ein Heft, das von Menschen am Rande der Gesellschaft für Sinnsuchende weiter in der Mitte gemacht wird. Es ist ein ehrenwertes Organ und es freut mich, dafür geschrieben zu haben.
Hier sind die Gedanken aus der Ausgabe N° 439/18 von SURPRISE.
DIGITAL DETOX:Wie bekommt man die Versuchung des Digitalen in den Griff? Und was macht man mit der gewonnenen Zeit?
Klar ist ein Smartphone nützlich, man würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Man hat immer ein Lexikon zur Hand, braucht keine Landkarten und Tickets mehr, steht immer auf verschiedensten Ebenen in Kontakt mit seinen Freunden und verfügt sogar über ein Spielzeug, wenn einem langweilig ist. Dass das Smartphone gleichzeitig eine Art elektronischer Fussfessel, eine Ersatzbeziehung für real existierende menschliche Kontakte und ein Suchtmittel ist, steht allerdings auch fest. Aufgeklärte Zeitgenossen wissen, dass jede Errungenschaft auch Opfer fordert.
Doch in der öffentlichen Diskussion zum Thema Internet-Sucht stehen sich grob gesagt zwei unversöhnliche Lager gegenüber: Die Warner und die Euphoriker. Die Warner sind meistens schon etwas älter, sind ohne World Wide Web geboren und betrachten die Zeit, die heute fürs Netz draufgeht, als Bedrohung von Bildung, sozialem Frieden und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die oft jüngeren Euphoriker sind meist mit dem Internet geboren, mit dem Laptop oder Handy in der Hand aufgewachsen und betrachten die Parallelität der virtuellen und realen Existenz als bereichernd, stimulierend und den Horizont erweiternd. Beide Lager haben in der Regel wenig Verständnis für einander.
Symbolisch für diese beiden diametral entgegengesetzten Positionen steht ein berühmt gewordener Schnappschuss aus dem Rijksmuseum Amsterdam, das eine Gruppe Jugendlicher zeigt, die auf einer Bank sitzt und ganz auf Smartphones fixiert ist. Keiner würdigt das Bild, vor dem die Kids sitzen – immerhin die „Nachtwacht“ von Rembrandt van Rijn (1606-1669), eine Ikone der klassischen Malerei. Googeln die Jugendlichen gerade alle den Maler, entdecken sie online gerade die Biografie des niederländischen Meisters? So „lesen“ Netz-Euphoriker das Foto. Ganz anders interpretieren es die Skeptiker: Das Foto beschwört für sie das Bild einer Generation herauf, die vor lauter digitaler Verlockungen kein Auge mehr für ihre „reale“ Umwelt hat und sogar grosse Kunst ignoriert. Das Ende der Zivilisation.
Ist es so simpel? Natürlich nicht. Auch der Fotograf Gijsbert van der Wal, der das Foto 2014 aufnahm, weiss nicht mit absoluter Sicherheit, womit die Kids gerade beschäftigt waren. Es könnte auch sein, dass sie gerade die neue Museums-App auf ihren Geräten installiert hatten, mit der Zusatzinformationen zum Bild abgerufen werden können – etwa, um damit eine Hausarbeit zu lösen.
Auch junge Leute, die nach 1995 geboren sind und für die es das Internet immer gab (man nennt sie „digital natives“), sehen in der Allgegenwart des Netzes teilweise eine Gefahr. Sie beginnen sich gerade zu fragen, ob man dem Netz überhaupt trauen kann. Und gerade sie sind es, für die ein Leben ohne Mobiltelefon fast schon rebellische Qualitäten hat. Umgekehrt gibt es auch unter den Alten, also den „digital immigrants“, etliche Internet-Fanatiker, die den freien Zugang zu Medien, Datenbanken und allerlei Formen der Online-Unterhaltung beklatschen und gerne verbleibende Lebenszeit ins Netz investieren.
Zwischen den beiden Polen gibt es vermehrt Menschen aller Altersgruppen, die sich fragen, ob das Internet in der kurzen Zeit seines Daseins nicht etwas viel von unserer Aufmerksamkeit einfordert und uns zu Sklaven des (vermeintlichen) Fortschritts gemacht hat. Unabhängig von Jahrgang, sozialem Stand und Bildung beginnen die Menschen, nach Gegenstrategien zu suchen, um der digitalen Permanenz wenigstens zeitweise zu entkommen. „Digital Detoxing“ verspricht einen solchen Entzug. Digitales Entgiften, also das bewusste Ab- und Ausschalten des Smartphones zwecks Wiederfindung eigener Impulse, wird gesellschaftsfähig.
Beim Digital Detox geht es darum, sich bewusst zu werden, welche Folgen die digitale Permanenz für die innere Balance hat und wie abhängig man von Netz und Handy geworden ist. Der erste Schritt ist das Bewusstwerden: Man erkennt, wie Smartphones, E-mails, Social Media und Messenger Lebenszeit und Energie auffressen und bekommt das Gefühl, dass das Leben an einem vorbeizieht, während man auf dem Bildschirm des Handys herumfummelt. Im zweiten Schritt geht es darum, Gegenmassnahmen zu ergreifen. Dies erfordert Willensstärke, und damit Digital Detox wirklich funktioniert, ist oft ein radikaler Wandel in der Lebensführung nötig.
Wie jeder Entzug fordert die Abkehr von der digitalen Permanenz Nerven und Willensstärke. Ein Teil des individuellen Umfelds wird den Kopf schütteln. Man muss den Verdacht aushalten, ein Technikfeind, Kulturpessimist und Fortschritt-Skeptiker zu sein. Dabei ahnt jeder, der ein bisschen nachdenkt, dass wir nicht stets auf Empfang sein können. Die Hirnforschung bestätigt zwar, dass wir einen veritablen Supercomputer unter der Schädeldecke haben. Dieser läuft aber – anders als elektronische Betriebssysteme – nicht optimal, wenn viele Programme gleichzeitig geöffnet sind.
Je nach Sichtweise kostet Digital Detox Zeit – oder es führt dazu, dass man zusätzliche Stunden gewinnt. Man de-investiert auf der Online-Seite und gibt sich neue Offline-Zeit. Es gelingt, wenn man einfach mal den Einschaltknopf des Mobiltelefons drückt und zuschaut, wie es runter fährt. Auch wenn ihn kaum jemand noch benutzt und er gut versteckt ist: Diese Geräte haben (noch!) einen Knopf, um sie abzuschalten! Schwer und still liegt das Handy nun auf dem Tisch oder in der Jackentasche.
Bei den meisten setzen bei einem schwarzen Bildschirm sogleich die Symptome des Entzugs ein: Man wird nervös und es beschleicht einen das ungute Gefühl, etwas zu verpassen. Man greift wiederholt nach dem Gerät und hofft auf ein Signal – eine Message, eine E-mail, ein Like oder ein Kommentar auf Social Media. Wir sind so programmiert: Immer auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung. Kommt diese nicht, werden wir unsicher. Zudem merken wir, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir mit uns selbst anfangen, wenn man einfach so dasitzt.
An diesem Punkt wäre ein Gedanke hilfreich: Vielleicht geht es im Leben ja gar nicht darum, stets leistungsfähiger zu werden? Vielleicht ist es angesichts der unbeschränkten Möglichkeiten ja auch mal Zeit, Dinge nicht zu tun? Der Gedanke wird die Symptome des Entzugs allerdings nicht lange unterdrücken. Am Anfang werden die Offline-Pausen darum kurz sein. Rasch schaltet man wieder ein – es gibt ja so viel zu sagen, kommentieren, tun, erledigen, schreiben. Dennoch sollte man die Kadenz und Dauer der Offline-Zeiten schrittweise erhöhen. Manche werden mit wenig zufrieden sein, andere brauchen längere Pausen – die richtige Dosis ist so individuell wie das Bedürfnis nach Schlaf oder Sport.
Um sich Pufferzeit zu schaffen, helfen auch Abwesenheitsmeldungen, etwa eine Botschaft, wonach man E-mails nur einmal täglich beantwortet. Damit verschafft man sich selber Zeit zum Nachdenken – und fordert vom Absender automatisch ein bisschen Bewusstsein ein. Allein dieser Nebeneffekt kann andere dazu bringen, über eigene Strategien des Detoxing nachzudenken. Wirklich Vielbeschäftigte wissen auch: Viele E-mails erledigen sich selbst, wenn man sie eine Weile liegen lässt. Natürlich muss man es sich leisten können, solche Zeitreserven einzufordern – gewisse Berufe erlauben es nicht. Man muss es sich aber auch leisten wollen, auf die Gefahr hin, in gewissen Fällen etwas zu verpassen oder gar Kontakte zu verlieren.
Die gewonnene Zeit könnte man dazu investieren, die „reale“ Dimension des Lebens neu zu entdecken. Denn je digitaler unser Leben ist, umso stimulierender ist es, etwas Haptisches oder Handwerkliches zu tun. Man kann Musik spielen oder Schallplatten auflegen, stricken, häkeln, nähen, zeichnen, malen, modellieren, gärtnern, schreinern, schnitzen, Bier brauen oder kochen – viele manuelle Tätigkeiten werfen sogar ein greifbares Produkt ab. Schnelles digitales Detoxing erlaubt auch das Velofahren: Es erfordert den Einsatz beider Hände, man greift also weniger zum Smartphone, man sieht mehr von der Welt und wird ganz von selbst ein ausgeglichenerer Mensch. Deswegen sollte man sich davor hüten, auch aus dem Fahrrad ein vernetztes elektrisches Gerät zu machen.
Ein wichtiger Schritt zum Digital Detox ist zudem, die Social-Media-Aktivität einzuschränken. Braucht man wirklich sowohl Instagram wie Facebook? Oder reicht ein Kanal? Würde es genügen, dort einmal am Tag vorbei zu schauen, statt kontinuierlich zu checken, was los ist? Und muss man dauernd die Beiträge anderer Menschen kommentieren? Gewiss, die Algorithmen der Anbieter belohnen jene, die viel plappern, aber: Macht es einen auch glücklich, ständig Botschaften an die Timeline von anderen Leuten zu kritzeln und jeden Mist mit dem Freundeskreis zu teilen?
Eine gute Strategie ist schliesslich, konsequent Gift und Galle zu entsagen. Böse Kommentare, polemische Debatten und Hetze gegen Minderheiten sind im Netz leider der Normalfall – wer sich zu sehr damit befasst, für den wird Grobheit auch im „realen“ Alltag eine Option. Der Verrohung entkommt man, indem man bei Anzeichen von Unmut erst mal an der frischen Luft spazieren geht, statt etwas Böses in die Tastatur zu hämmern. Die Welt ist auch ohne Shitstorms anstrengend genug.
Wenn man dann und wann doch etwas schreibt, dann bitte richtig: E-mails in absoluter Kurzform zu verfassen ist etwa so, als würde man sein Gegenüber im Kasernenton mit Aufgaben eindecken. Zu einer gepflegten Konversation gehören auch heute noch anständige An- und Abreden, Interpunktion, Grammatik und ein Hauch von Emotionen. Im digitalen Dauerrausch einen Rest von Anstand und Form zu bewahren, ist eine zivilisatorische Leistung, die man nicht dem Diktat der Effizienz opfern sollte.